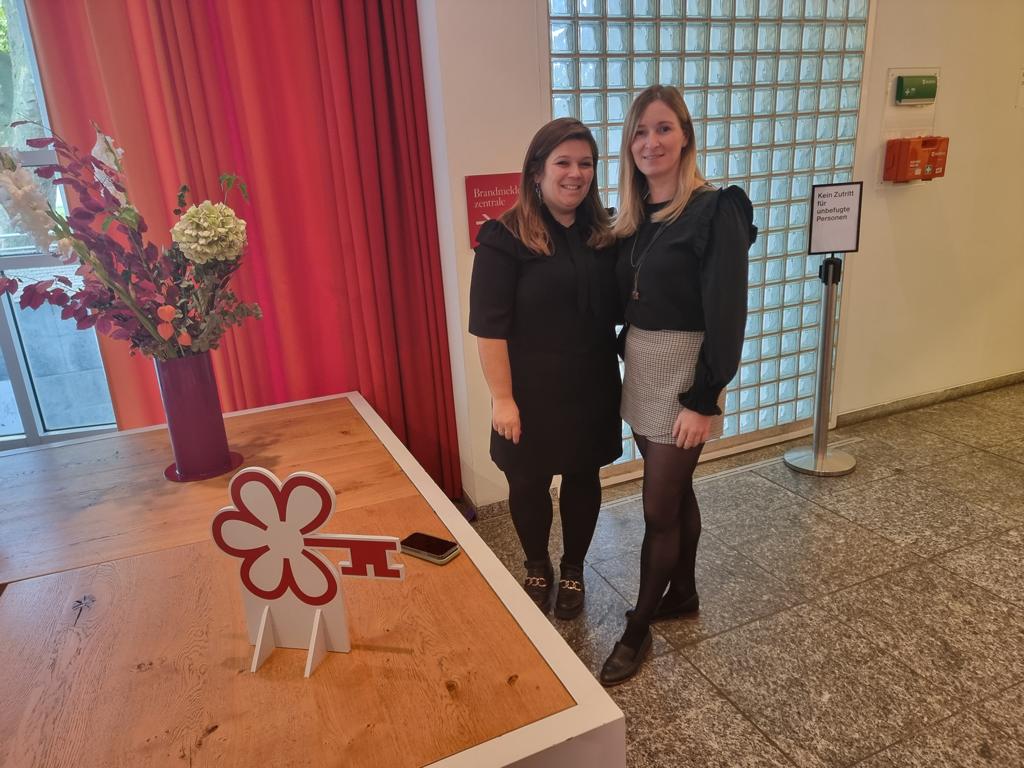In vielen Regionen Deutschlands sind inzwischen jene Industrieanlagen stillgelegt oder umgenutzt worden, die einst das Rückgrat der lokalen Wirtschaft bildeten. Diese alten Fabriken und Produktionsstätten könnten zu Museen, Kultur- oder Einkaufszentren umgewandelt werden. Doch die Frage, ob durch solche Maßnahmen ein nachhaltiger Tourismus entstehen könnte, bleibt. Konzentrieren sich die Städte lieber darauf, ihren Industriestandort zu halten oder sich zu einem Dienstleistungszentrum zu entwickeln? Wir betrachten die Porzellanstadt Selb und die Uhrenstadt Glashütte.
Konzept für den touristischen Umbau in Selb?
Selb bezeichnet sich als Weltstadt des Porzellans. Die Porzellanindustrie in Selb entwich, lediglich Rosenthal und ein Hotelporzellan-Hersteller überlebte, Rosenthal übernahm praktisch alle Porzellanmarken. Zahlreiche Plätze im Stadtbild erinnern an die einstige Porzellanwelt. Industrielle bauten hier Theater und Sportstätten.
Einer privaten Initiative ist es zu verdanken, dass Selb ein Porzellanmuseum beherbergt. Auf dem Gelände von Rosenthal und Heinrich werden Fabrikverkäufe betrieben. Aus der Porzellanfachschule wird eine Hochschule für Design. Doch Selb konnte sich trotz schöner Landschaft und vielen Festen nicht als attraktive Touristendestination etablieren.
Das Kernproblem dafür war der demografische Wandel: Die einst zahlreich vertretenen Porzelliner gibt es kaum noch, und die mickrigen Renten entziehen der Gastronomie die Lebensgrundlage.
Es konnten zwar neue Arbeitsplätze bei erfolgreichen Mittelständlern geschaffen werden. Aber jene Mitarbeiter leben oft auswärts; von der Arbeit geschafft, kehren sie selten ein.
An einem schönen Sommertag finden sich bei der Eisdiele Cortina mit etlichen Außenplätzen nur wenige Gäste ein. Früher war alles anders. Die Stadt wünscht sich Tourismus. Dies erfordert in Selb gemütliche Boutiquen und Porzellan-Künstler, damit die Menschen vor Ort “ins Porzellan eintauchen” können. Solche Erlebnisse sind wichtig und dürften den Porzellankauf bereichern.
Glashütte weiterhin ein führendes Zentrum der Uhrenindustrie
Nach dem Zusammenbruch der DDR schafften findige Unternehmer mit starken Marken den Einstieg in den Weltmarkt. Walter Lange und Günter Blümlein erklärten einst: “Wir werden in Glashütte eine Uhr fertigen und diese für DM 100’000,- verkaufen.” Ein verrückter Plan, doch heute kann eine Uhr sogar Euro 2’100’000 kosten.
2000 Mitarbeitende arbeiten in der Uhrenindustrie, Glashütte hat sich ganz auf die Uhrenindustrie ausgerichtet. Uhrmacher machen einen speziellen Menschenschlag aus, ruhig und konzentriert tritt ihre Eigenheit in Erscheinung. Auch sie kehren abends gern nach Hause zurück, um sich auszuspannen.
In Glashütte, beim Bahnhof, reihen sich die Uhrenfabriken aneinander. Werksverkäufe existieren hier keine, entsprechende Boutiquen befinden sich in Dresden. Lediglich zwei Uhrenhändler und Reparaturgeschäfte gibt es in Glashütte.
Als Ausflugsziel hält Glashütte mit dem Deutschen Uhrenmuseum einen Trumpf in der Hand. Immer wieder frischen spannende Sonderausstellungen deren Besichtigungen auf, wie beispielsweise “Die Zeit ist weiblich”, wodurch aufgezeigt wird, wie in der einstigen Männerdomäne Frauen die Uhrenindustrie prägen. Neben dem Deutschen Uhrenmuseum liegt, angepasst an die Öffnungszeiten des Museums, ein gemütliches Restaurant mit Café.
Abends verstummt Glashütte, friedlich und still ist`s, vielleicht möchten das die Uhrmacher so. Man wünscht sich allerdings mehr Tourismus – wirklich? Oder ist das nur ein Lippenbekenntnis? In Glashütte ist die Tourismusinfo jedenfalls schwer zu finden. Selb hingegen setzte ihre Tourismusinfo neuerdings in die Stadtmitte. Die meisten Besucher von Selb fahren mit dem Auto zum Fabrikverkauf und vielleicht noch ins Museum. Was müsste geboten werden, damit mehr Besucher das Stadtleben und die wunderschöne Umgebung genießen.
Dazu bräuchte es jenes Lebensgefühl einer Porzellan- oder Uhrenstadt, und dieses Gefühl wird durch Menschen geprägt!
Fazit
Tourismus ist ein hart umkämpfter Markt. Wie sollten hierzu touristische Angebote aussehen? Jenes Flair der Einzigartigkeit von Porzellan, das Selb einst schmückte und prägte, kann heutzutage nur durch Menschen weiterleben, die diese Traditionen hochhalten.
Chancen für den Tourismus durch die Industrie
Falls Industriebetriebe schließen, könnten aus den Fabriken Hotels oder schöne Wohnungen entstehen. Doch das ist kein Erbe, das Erbe ist in den entsprechenden Mitarbeitern festgeschrieben. Industrie und Tourismus zusammen, ginge das? Anhand meiner Betrachtung von Selb und Glashütte erkenne ich, dass dank der Industrie nur wenig Tourismus entsteht.
Ein Übergang von einem Industriestandort zu einem touristischen Standort kann nur in seltenen Fällen gelingen und erfordert umfassende Planung und Unterstützung. Städte wie Selb und Glashütte zeigen, dass der Weg dorthin oft steinig und nicht durchweg mit Erfolg gekrönt ist.
Bedeutsame Faktoren für einen möglichen Erfolg sind:
Ein touristisches Konzept
Es obliegt einem hier, Einzigartigkeit und Attraktivität hervorzuheben, dies benötigt eine klare Positionierung. Gerade hinsichtlich kleinen Orten braucht es eine Zusammenarbeit und gute Vernetzung mit Nachbarregionen. Dazu sollte der öffentliche Verkehr genutzt und besonders die davon betroffenen Menschen und Sehenswürdigkeiten der Umgebung einbezogen werden.
Einheimische einbinden
Die Unterstützung der lokalen Bevölkerung und eine starke Gemeinschaft, die stolz auf ihre Geschichte ist und diese aktiv fördert, sind relevante Erfolgsfaktoren. Je mehr Gastfreundschaft gelebt wird, desto lieber erscheinen die Gäste. Dazu liegen viele Ideen brach. Auch eine eigene Währung in Form von Gutscheinen kann hilfreich sein. Solche Gutscheine sollten durch die Einheimischen verdient werden können und damit Gastronomie, Museumseintritte, Stadtführungen, Konzerte bezahlt werden können.
Vielfältige Angebote
Auch die Industrie kann ein wertvolles touristisches Potenzial bieten, sofern es gelingt, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen und das Interesse der Besucher zu wecken. Wichtig ist der Einblick in die Produktion durch Schauwerkstätte oder Kurse, um künstlerische Fähigkeiten zu lernen. Eine finanzielle Unterstützung der Industrie ist geboten.
Ein breites Spektrum an Aktivitäten und Attraktionen muss klar kommuniziert werden und dies nicht nur im Internet, sondern vor allem durch Hinweise vor Ort. Alle Einheimischen sollten immer Prospekte ihrer Heimatstadt griffbereit haben können, um auch auf Reisen davon erzählen zu können.